00:00
Herr der Hörner
Herr der Hörner
erschienen/erscheint bei:
Hoffmann und Campe, 9/2005
735 Seiten, gebunden
Mit Karten & Lesezeichen
Verlag Hoffmann und Campe
ISBN (10) 3-455-05892-2
ISBN (13) 978-3-455-05892-5
€ 25,– [D]
€ 25,70 [A]
sFr 43,90
Entstehungszeitraum: 23/06/2001 - 27/04/2005
Weitere Formate und Veröffentlichungen
Herr der Hörner (Taschenbuchausgabe)
 Herr der Hörner (Taschenbuchausgabe)
Herr der Hörner (Taschenbuchausgabe)Taschenbuchausgabe
Goldmann
Preis: EUR 9,95
Broschiert: 831 Seiten
ISBN-10: 3442462819
ISBN-13: 978-3442462810
E-Book "Herr der Hörner"
 Herr der Hörner
Herr der HörnerAls E-Book am 22.7.2013 erschienen bei Hoffmann und Campe
Dateigröße: 5 MB
Seitenzahl der Printausgabe: 736 Seiten
€ 5,99
Kindle-Edition bei amazon.de: http://www.amazon.de
EPUB bei buecher.de: http://www.buecher.de
iTunes: https://itunes.apple.com
Textauszug u.d.T. "Fahler Fleck im Auge" in: Hubert Winkels (Hg.): Beste deutsche Erzähler 2004. München (DVA) 2004; Auszug u.d.T. "Nie wieder Deutschland. Abschiedsgesang des Herrn Broder Broschkus" in: Süddeutsche Zeitung, 9/1/04; Auszug u.d.T. "Das letzte Lächeln des Herrn Broder Broschkus" in: ADAC-Sonderheft "Hamburg", 3/04; auszugsweise gesendet im Deutschlandfunk (Lesezeit), 8+15/6/05; Textauszug in: Volltext. Zeitung für Literatur. Nr. 4/2005
Über das Buch
Mit drei rätselhaft beschrifteten Zehnpesoscheinen in der Tasche macht sich Broder Broschkus auf nach Santiago de Cuba. Dort, im schwarzen Süden der Insel, sucht er eine Frau, von der er nur eines weiß: Bei einer flüchtigen Begegnung hatte sie ihm einen der drei Geldscheine zugespielt – aber welchen?
Im Verlauf seiner Suche erkundet Broschkus erst das weltliche, bald auch das religiöse Leben der Stadt: Hunde- und Hahnenkämpfe, Exhumationen und Hausschlachtungen üben eine rätselhafte Faszination auf ihn aus, zunehmend auch die afrokubanischen Kulte, denen man nicht nur in den Elendsviertels anhängt. Ganz Santiago des Cuba scheint von etwas Dunklem beherrscht, über das zwar keiner reden will, auf dessen Spuren Broschkus nichtsdestoweniger immer häufiger stößt. Daß die gesuchte Frau damit in Verbindung steht, wird Broschkus bald klar; wie sehr sie freilich Werkzeug oder gar Verkörperung des Bösen ist, ahnt er nicht.
Um diesen Roman schreiben zu können, mußte Matthias Politycki tief in die Ritualwelt der afrokubanischen Religionen eintauchen. „Herr der Hörner” zeichnet ein genau recheriertes Bild des harten kubanischen Alltagslebens, kreist in seiner Tiefe jedoch um existentielle Fragen: um eine Abrechnung mit den Dekadenzsymptomen eines im Niedergang begriffenen Deutschland; um den Überlebenskampf eines aufgeklärten Europäers in einer archaisch „afrikanischen” Welt, die mit all ihren Grausamkeiten auch eine umfassende religiöse Geborgenheit verbürgt; um Grenzerfahrungen des Glaubens, die selbst vor einem Menschenopfer nicht zurückschrecken.
Leseprobe
Kapitel I: Fahler Fleck im Auge
Das Helle vergeht,
doch das Dunkle, das bleibt. Als Broder Broschkus, erklärter Feind allen karibischen Frohsinns, die Stufen zur „Casa de las tradiciones“ hochschwitzte, hinter sich eine Frau, die er in dreizehn wunderbaren Ehejahren so gut wie vergessen hatte, beherrschte er nach wie vor nur zwei spanische Vokabeln, „adios“ und „caramba“ – ja/nein, links/rechts und die Ziffern von eins bis zehn mal nicht mitgezählt. In stummer Empörung die Blechfanfaren registrierend, die ihm auch hier entgegenfuhren, überschlug er die Stunden, die bis zum Heimflug noch zu überstehen waren, keine geringe Lust verspürend, dem Türsteher anstelle des geforderten Touristendollars einen Tritt zu verpassen; daß er sich auf dieser Treppe knapp zwei Stunden später seinem Tod entgegenstürzen sollte, konnte er ja nicht ahnen. Am Ende eines Pauschalurlaubs war‘s, die Koffer bereits gepackt und kurz vor zwölf, an einem Samstag mittag unter farblosem Himmel.
Welch Kühle dann aber drinnen, wie dämmerdunstig das Licht! Obwohl der Schlagwerker mit Lust auf einen Pferdeschädel schlug, was ein scharfes Rasseln der Kiefer erzeugte, obwohl der Bassist die Lippen an die Wölbung eines Tonkrugs legte, um mit dicken dunklen Fingern aus dessen Öffnung Töne hervorzuzupfen, obwohl der Rest der Kapelle mit Inbrunst in diverse Tröten stieß, hingen die Einheimischen schlaff in ihren Schaukelstühlen, nippten aus weißen Plastikbechern, rauchten Zigarren, die einer der ihren inmitten des Raumes für sie drehte: Als er seinen Kopf hob, um Broschkus einen Blick lang zu mustern – die andern schienen ihn überhaupt nicht wahrzunehmen –, war sein tiefschwarzes Gesicht von Falten überstrahlt. Lediglich ein paar kleine Kinder, so sie nicht zwischen den kuhfellbespannten Hockern Verstecken spielten, hinter den gedrungnen Rumfässern, die als Tische dienten, lediglich ein paar Kinder tanzten direkt vor den Musikern, gleichgültige Mienen machend und interessierte Hüftbewegungen. Das also war sie, die berühmteste Kneipe Santiagos, von der ihm Kristina aus dem Reiseführer vorgeschwärmt hatte, ein krönender Kontrapunkt zu Palmen, Wasser, Sand, und bestimmt würde sie das alles gleich „toll“ finden, „wahnsinnig aufregend“. Nach Verfaulendem roch’s, wahrscheinlich vom Hinterhof her Hühnerschenkel oder tote Katze, nach verschüttetem Rum roch’s und verschwitzten Schuhen, schwadenweise auch nach Frittieröl und schwerem Parfum, ein feiner Faden Urin zog sich, scharf und präzis, bis in einen rückwärtigen Raum, wo Dominospieler stumm auf die Steine starrten. Wenn durch die Fensteröffnungen nicht gerade warm ein Windstoß gefahren wäre, Broschkus hätte sicher auf der Stelle kehrtgemacht.
So aber war er, kaum daß er beim Barmann ein paar kreisende Zeigefingerbewegungen gegen ein Zahnlückengrinsen getauscht, so aber war er, kaum daß er mit einem Mojito (für die señora, si si) und einem überraschend kalten Cristal an einigen weißgestrichnen Säulen vorbei bis zum erstbesten Eckplatz gelangt, so aber war er fast umgehend in einen Dämmerzustand gefallen. Unterm gleichmäßigen Dahinlärmen der Musik zerflossen die rosa Bretterwände mit den Bildern berühmter Sänger und sogar dem eines riesigen Christus, der als Wandgemälde hinter den leibhaftigen Sängern aufragte samt Bischofshut und schlangenförmig sich windendem Schwert, zerflossen zu einer südlich diffusen Melancholie; nur selten mußten kleine Fliegen verscheucht, mußte ein Schluck Bier genommen werden, die Augen halb geschlossen, und weil die Deckenventilatoren so gleichmütig schrappten, wäre man beinahe eingeschlafen, erschöpft von zwei Wochen karibischer Sonne und wechselweis sich reihenden Wortlosigkeiten.
Ehe Broschkus dann aber wirklich einnickte, ging er schnell noch mal zur Bar, der Tresen nichts weiter als ein der Länge nach aufgesägtes und -geklapptes Faß, hinter dessen bauchig nach außen gewölbten Hälften, so vermutete er, die Peso-Flaschen für die Einheimischen versteckt waren; ein zweites Faß hatte man auf gleiche Weise geteilt und, nachdem man dem halbierten Rumpf je ein Regalbrett für den offiziell angebotnen Dollar-Rum eingefügt, an der Wand hinter der Theke montiert. Noch eins? zahnlückengrinste ihm der Barmann entgegen, der einzige Weiße hier offensichtlich, und hielt bereits die Dose in der Hand. Noch eins, nickte Broschkus und hielt bereits den gefalteten Geldschein zwischen Zeige- und Mittelfinger, fast so beiläufig wie ein Einheimischer.
Da sah er sie.
Sah die beiden Freundinnen,
oder waren sie ihm nicht längst aufgefallen, die sie kichernd auf ihren Hockern gesessen, einander Wichtigkeiten verratend? Natürlich, insbesondre die eine: So jung! hatte er sich erschrocken, so hellbraun wie, weiß der Teufel, wie – Honig? Meinetwegen wie dunkler Honig, verdammt dunkler Honig, war Broschkus vollends aus dem Dahindämmern herausgeraten, und jetzt schau weg.
Anwesend, ziemlich anwesend war sie trotzdem, die mit der honigbraunen Haut, die mit den langen schwarzen Locken, dem zahnstrahlenden Lachen, das noch den hintersten Winkel des Raumes ausleuchtete, in dem sich das Ehepaar Broschkus verborgen hielt; und erst recht den Tresenbereich, wo der Ehemann Broschkus etwas langwierig eine leere gegen eine volle Dose tauschte. Um nebenbei festzustellen, nur aus den Augenwinkeln: daß diese Frau, die im Grunde gerade noch als Mädchen gelten mußte, daß dies Mädchen, das im Grunde gerade schon als Frau gelten durfte, mit einer schäbigen Radlerhose bekleidet war, gelbschwarz gestreift wie das Bustier, daß seine Sandalen sehr simpel und die Sohlen höchstwahrscheinlich aus Autoreifen gefertigt waren, oh ja, selbst das glaubte Broschkus erkannt zu haben. Nichtsdestoweniger verwandelte‘s sich, das Mädchen, je länger man‘s auf solch beiläufig blöde Weise belauerte, verwandelte sich allein durch sein Lachen in die, Teufel auch, in reinste Anmut, ja, Broder, das Wort ist ausnahmsweise angemessen, bebrummte sich Broschkus, und jetzt zieh ab.
Kein Wunder, daß er sich später nicht recht an die andre der beiden erinnern wollte, nur daß sie weit größer, vor allem breiter gewesen, nicht eigentlich dick, eher mächtig, ja nachgerade muskulös, erschreckend muskulös, dessen würde er sich nach diesem 5. Januar noch sicher sein, daß sie viel dunkler gewesen, so dunkelbraun wie – die Zigarren vielleicht, die der zierliche Alte mit großem Ernst rollte? Daß sie blauweiße, rotweiße Halsketten getragen, anstelle von Haar einen bräunlich eingefärbten Kräuselwust, einen Mopp, der an den Wurzeln seine natürliche Schwärze zeigte, auch ein Straßherz am Gürtel, nicht wahr?
Aber jetzt, jetzt tanzten sie.
Promt bliesen die Bläser eine Spur beherzter,
trommelten die Trommler eine Spur heftiger, härter, das Glitzern auf der Haut der beiden Tänzerinnen wurde lediglich vom Leuchten ihrer Zähne überboten.
Oh Gott, dachte Broschkus, will denn keiner was dagegen –
Oh nein, dagegen einschreiten wollte keiner, am wenigsten Broschkus; die beiden tanzten in solcher Selbstverständlichkeit, daß man gar nicht gewagt hätte, sie zu unterbrechen, tanzten so selbstgewiß aus der Mitte ihres Wesens heraus, so selbstgefällig, selbstherrlich bis in die Spitzen ihrer Glieder, so selbstverliebt, sogar die Dunkle, ein Glanz lag auch auf ihr, mit ihren schweren Flanken schlug sie auf eine unwiderlegbar weibliche Weise Funken. Und erst die Hellere, Jüngere, oh, wie selbstvergessen sie die Arme übern Kopf hob, wenn sie sich um die eigne Achse drehte, man hatte beim Trinken Mühe, nichts zu verschütten. Ihre honigfarbene Haut, an manchen Stellen legte sich ein Licht darauf, als schiene die Sonne für sie auch hier drinnen, mal an den Schenkeln, mal am Bauch, mal an den Armen, immerzu liefen ihr helle Flecken übers Fleisch, am schlimmsten freilich über die Nacktheit der Schultern.
Beim Abstellen der Dose wollte’s Broschkus scheinen, sein Blick habe den ihren kurz gestreift, und als er gleich wieder nach der Dose greifen mußte, verschüchtert in ihre Richtung schielend, fuhr ihm ein warmer Wind durch den Raum, durch die offne Tür herein über die Tanzfläche zum Rückraum hinaus in den Hof, daß ihm die Zunge gegen den Gaumen schlug: Hatte sie etwa eine kleine Handbewegung in seine Richtung gemacht, eine kaum wahrnehmbare Geste der Aufforderung? Broschkus konzentrierte sich auf den mit dem Strohhut, auf den daneben in den zwei verschiednen Schuhen, schließlich auf den Zigarrenmacher: Der trug eine Kette aus kleinen weißen Plastikperlen? Körnern? Und wieso konnte die Dose schon leer sein? Oder war das erneut die winzige Handbewegung, die keinem andern als ihm gelten konnte, ausgerechnet ihm? Die Leichtigkeit, mit der diese – Person ihre Hüften zum Flimmern brachte, die Direktheit, mit der sie ihm offen zulächelte, die Dreistigkeit der beiden Hände, die nach der weiter und weiter flimmernden Schmalheit der Hüften griffen, an ihr emporfuhren, langsam über die Taille nach innen zu, übern nackten Bauch, dann aber doch nicht über die Brust, oh nein, das eben nicht! sondern erst im Haar sich wieder verfingen, es scheinbar ordnend, zur Seite hin raffend, um übern Kopf hinaus sich zu heben, in stolzer Gewißheit eine ganze Weile den Tanz des restlichen Körpers mit einem Spreizen der Finger kommentierend: gewiß nur für ihn, den Fremden im Eck, den sie weiterhin fixierte, nicht wahr, weiterhin belächelte, nicht wahr, dem sie weiterhin und vor allen andern sich zeigte? Indem sie ein paar Schritte sogar in seine Richtung setzte, rein spielerisch, gleich würde die Drehung kommen –
Broschkus verschluckte sich so heftig, daß er husten mußte.
Denn die Drehung,
mit der zu rechnen gewesen, sie blieb aus, statt dessen – der Zigarrenmacher, trug er nicht auch am Handgelenk eine weiße Kette? – ging sie durch dieses Licht, diesen Lärm, ging ganz offen auf ihn zu, schon konnte er ihre hervortretenden Beckenknochen sehen, die konkav dazwischen konturierte Bauchdecke; gerade noch gelang’s ihm, die Bierdose abzustellen, da hatte sie ihn bereits an der Hand, zog ihn vom Hocker wie einen kleinen Jungen. Ihr Blick, aus der feuchten Tiefe eines grün schillernden Kaffeesatzes heraus mit feinem hellbraunen, honigbraunen Außenrand, bloß nicht länger in diese Augen sehen, bloß nicht. Im Losstolpern bemerkte Broschkus, daß die Große, die Breite, die Schwere ebenfalls herbeigekommen war, um Kristina zu ergreifen – man hatte sich also abgesprochen –, schon waren sie alle vier in der Mitte des Raumes. Woraufhin die Kapelle wirklich loslegte, ein pferdeschädelrasselndes Höllenspektakel, einige der Einheimischen riß es aus dem Dahindösen, man klatschte im Takt, sang laut mit, sogar der Zigarrendreher hob kurz seinen grauweißen Kräuselkopf, von dem sich die Ohren wegwölbten. Salsa!
Ausgerechnet Salsa,
den Broschkus so haßte. Notdürftig brachte er seine Beine in Bewe-gung, eher die Darstellung eines Tanzes als der Tanz selbst, wollte sich auf die silbernen Zehennägel vor ihm konzentrieren, auf die braunen Füße in den billigen Sandalen, auf Knöchel, Sehnen, Wadenmuskeln; doch das Mädchen, in wundersam weichen Bewegungen sich wiegend, verstand ihn sofort, schenkte ihm seine langen schwarzen Locken, die jeder Bewegung synkopisch hinterherwippten, und als Broschkus den Blick vollends zu heben wagte, lachte ihn mit dunklen Lippen an, zwischen den oberen Schneidezähnen eine winzigschwarze Lücke. Indem sie sich von ihm abdrehte, flogen ihm ihre Haare ins Gesicht; indem sie sich gleich wieder zu ihm zurückdrehte, ließ sie sich näher an ihn herantreiben, so nah, daß sie – wie erschrocken mit langen schmalen Fingern nach ihm faßte, den vollständigen Zusammenprall abzufedern, selbst das noch Teil derselben fließenden Bewegung, und natürlich wußten ihre nackten braunen Hüften, was sie da taten, als sie die des Herrn Broder Broschkus im Vorüberstreifen berührten und –, nun erst glitt‘s an ihm vorbei, das Mädchen, hauchte ihm seinen Atem ins Ohr. Verströmte dabei kein süßliches Parfüm, wie Broschkus mit riesig entsetzten Nüstern feststellen mußte, sondern unvermischt und mit Macht nur herben Duft, sich weiter wiegend im Takt, als sei‘s ganz allein auf der Welt, nicht etwa in bedenklicher Nähe zu einem leicht verfetteten, leicht ergrauten Touristen. Oh wie häßlich Herr Broschkus sich fand, wie bleich, wie plump, und doch sah er deutlich vor sich die sanft verlaufende Linie eines Schlüsselbeins, sah das Funkeln in der Grube darüber, darunter, hörte’s aufrauschen, das Bier in seinem Kopf oder ein feines Sirren, sekundenbruchteilhaft erkannte neben sich Kristina, deren korrekt kostümierte Glieder unter der Regie der Dunklen, der Schweren, in ein munteres Gehopse geraten waren. Später wollte er sich vor allem an ihren verrutschten Rückausschnitt erinnern, ausgerechnet daran, und im nächsten Sekundenbruchteil –? War das ein Biß gerade gewesen, was er im Ohrläppchen verspürt, ein winziger Biß? Oder doch eher ein Kuß?
Oder bloß eine flaumhaardicht vorbeistreifende Kühle, schon zog das Mädchen den Kopf zurück, ja-warum-denn, erneut verwandelte sich in reinen Rhythmus, ein vielgliedrig akzentuiertes Wippen um die Körpermitte, das Broschkus zum tumb taumelnden Toren machte, mal stieß ihn die Trompete nach vorn, mal zog ihn das kurze Solo auf dem Tonkrug zurück, mal trieben ihn die Bongos in weiten Schritten hinter ihm her, dem Mädchen, mal riß ihn die Gitarre von ihm fort, und als er, außer Atem, nurmehr torkelte, da sah‘s ihn an, das Mädchen, sah ihn so voller Unschuld an, auf dem Jochbein ein schmales Schimmern, auf den Lippen ein spöttisches Lächeln, daß es gewiß kein Biß gewesen war, kein Kuß, nicht mal eine zufällige Berührung. So sehr sah‘s ihn an, das Mädchen, daß ihm die Nasenflügel bebten, so nackt und direkt sah‘s ihn an, so unmädchenhaft plötzlich, ganz und gar Frau jetzt, sah ihn aus seinen, aus ihren Augen an, grün lag ein Glanz darin, nicht als heißes Versprechen, sondern als kaltes Verlangen, das Broschkus vollends aus dem Rhythmus brachte. Da entdeckte er ihn: den feinen Riß in all dem Glanz, mitten im Grün der Iris ein farblos fahles Einsprengsel, millimeterbreit ein Strich im linken Auge, vom äußern Rand der Iris bis zur Pupille, vielmehr im rechten Auge, jaja, im rechten, ein Fleck.
Gleich! dachte Broschkus nicht etwa, fühlte’s freilich desto stärker: Gleich! tut sich die Erde auf und ich fahr‘ zur Hölle. Wie laut der Chor der Sänger nach ihm rief, wie unbarmherzig die Blechbläser nach ihm verlangten, wie schwer ihm der Atem rasselte! Da aber ergriff die Frau, mitten im Blick, im Trompetensolo und weiß der Teufel warum, ergriff eine seiner unbeholfen herumhängenden Hände, nun wieder ganz mädchenhaft keusch, und ohne ein Wort der Erklärung führte ihn zu seinem Sitzplatz.
Wo ihn niemand erwartete, nicht mal Kristina.
Als Broschkus zurückgesunken war auf seinen Hocker und keine Bierdose fand, nach der er hätte greifen können, beugte sich das Mädchen zum Abschied herab und – küßte ihn auf, nein: biß ihn ganz zart in den Hals? Kaum daß sich die Zähne in seine Kehle gruben, Broschkus bekam Gänsehaut, ich werd‘ verrückt, hier-jetzt-sofort verrückt! Doch wie er, geblendet von so viel Glück, den Blick nicht zu heben wagte, hatte man ihn bereits sitzengelassen. Neben einer korrekt frisierten Frau, die sich auf wundersame Weise in jenem Moment wieder eingefunden, vor einer Bierdose, die zwar leer, aber auf wundersame Weise wieder vorhanden war.
Daß ihm einer der Umsitzenden die Schulter klopfte, fühlte Broschkus nicht, doch die angebotne Zigarette nahm er ohne ein Wort des Dankes an. Und rauchte sie in einem einz‘gen Zug weg, der erklärte Nichtraucher, während er sich mit Müh‘ daran erinnerte, wo er und was er war, ein Doktor-rer-pol doch wohl immerhin? Gestandner Abteilungsleiter, Spezialist für Abwärtsspekulation und Leerverkauf? Oder ein blasser Tourist bloß, ungläubig die Kehle sich befühlend, die Tabakkrümel auf den Lippen? Der Deckenventilator, noch immer fächelte er ihm einen herben Geruch zu oder jedenfalls eine Luft, das Hemd klebte ihm an der Brust, die heftig auf und ab sich senkte, es war eine Schande. Wie gierig ihn die kleinen Fliegen umschwirrten!
Daß er irgendwann in die Nähe des Ausgangs geraten,
nach einem weiteren Cristal vermutlich und hinter einer eleganten Dame mit Rückenausschnitt, bekam Broschkus erst mit, als es zu spät war. Suchend blickte er sich um, entdeckte nur die Zigarrendunkle, die ihm jetzt, da sie ihre halskettenbehangne Schwere über einen der Hocker gestülpt hatte, die ihm jetzt, da sie sich eine Sonnenbrille mit blauen schmetterlingsflügelförmigen Gläsern in den Kräuselmopp gesteckt hatte, die ihm geradezu häßlich erscheinen wollte, ja, alles an ihr war zu leberfleckig, zu breitnasig, zu prall ausgefallen, vom Wangenknochen hoch durch die Braue lief ihr eine Narbe, selbst im Schweigen wölbte sich ihr Mund weit nach vorn, eine feucht glänzende Obszönität.
Deine Freundin, wo ist sie? blickte ihr Broschkus ins Auge, die Dunkle riß einen Keil in ihr Gesicht, ein hellrosarotes Zungenlachen, versetzt mit einem rauhen Schwall an Silben, aus der Tiefe einer verrosteten Gießkanne heraufgurgelnd. Draußen, auf dem Treppenabsatz, stand die Dame, drehte sich vorwurfsvoll um – ach, das war ja Kristina –, der Pferdeschädelrassler machte einen Schritt auf Broschkus zu, wahrscheinlich wollte er ihn in letzter Sekunde anschnorren. Wo ist sie? blickte Broschkus schnell zum Zigarrenmacher, doch der sah nicht mal her, rollte Tabakblätter zwischen seinen Händen. Wo? blickte Broschkus zum Barmann, der ihm zugrinste, zwei gestreckte Zeigefinger aneinanderreibend, Broschkus blickte wieder nach draußen. Dort hatte sich Kristina mittlerweile treppab begeben, die Sicht freigegeben auf – ein Mädchen: So selbstverständlich lehnte’s am Geländer, neben dem Türhüter, so selbstverständlich. Und sah ihm entgegen.
Herr Broder Broschkus, sofort erfüllte ihn wieder ein feines Sirren, geriet ihm jegliches in sanftes Schwirren; weil er aber nur zwei Worte Spanisch sprach, die Ziffern mal nicht mitgezählt, setzte er sich in Bewegung, ging schweren Schrittes auf die Silhouette zu und – vorüber. Während er bereits die Schuhspitze auf die erste Stufe setzte – welch Kühle mit einem Mal auch hier draußen! –, dachte er „¡caramba!“ und sagte, nein: flüsterte, nein: wisperte, denn die Zunge blieb ihm am Gaumen kleben: „adios“. Dann stürzte er treppab und zu Tode.
Nun ja,
um ein Haar. Was ihn gerettet hatte, jedenfalls für diesmal, war seine Frau; als er zehn Stufen tiefer angekommen, mit einem verknacksten Knöchel vermutlich und mit Kristina, die er im Schwung des Hinabstolperns mitgerissen hatte, war der Himmel weiß.
„Was für ein … Abschluß … Urlaubs!“
Jetzt nahm ihn Kristina auch noch an der Hand, zog ihn vor aller Augen weg, in die Mitte der Gasse. Welchen Abschluß sie wohl meinte, wieso Urlaub?
„Alles …, Broder?“
Ohne die Antwort abzuwarten, ging sie los. Doch wie sich der Herr Doktor, der gestandne Abteilungsleiter, widerwillig in Bewegung setzen und ein klein wenig dabei nach oben schielen wollte, blieb er gleich wieder stehen: Zwei Stufen auf einmal nehmend, rannte ihm nicht etwa der Türsteher, nein-nein-nein, rannte ihm das Mädchen hinterher, als ob er nicht etwa an der Seite einer andern Frau dort unten stand, rannte durch dieses Licht, diesen Lärm, auf ihn zu, mit einem Geldschein winkend. Gerade noch gelang‘s ihm mit einer ruckartigen Bewegung, sich der Fürsorglichkeit Kristinas zu entziehen, schon stand sie vor ihm, bebend bis in die Bauchdecke hinab:
Ob er den, bitte, in zwei Fünfer wechseln könne?
Die Zahlen, die beherrschte Broschkus, die verstand er sofort, dazu hätte sie ihm gar nicht ihre langen Finger zu zeigen brauchen, fünf Finger der linken, jajaja, fünf Finger der rechten Hand. Trotzdem war’s kein Leichtes, die gewünschten Scheine aus der Hosentasche hervorzusuchen, war’s unmöglich, ihr dabei ins Gesicht zu sehen, konzentrier dich, Broder, schau auf die Zehnpesonote, schau auf ihre Fingernägel, die sind nicht silbern sondern weiß, und versuch mal, nicht zu atmen.
Als er ihr die beiden Fünfer entgegenstrecken konnte, tat er’s gleichwohl – atmete den Duft noch einmal ein, der ihrem Körper entströmte oder jedenfalls der Welt, sank ins Grün ihres Blickes, daß er sich an der nächstbesten Hand festhalten mußte, deutlich zu sehen auch der streichholzdünne Strich, der fahle Fleck im rechten Auge oder vielmehr, ist-doch-wirklich-egal-jetzt, im linken.
„Naja, diese Lebensfreude hier, diese … geht mir manchmal ein bißchen …“
Das mußte Kristina sein, die ihn da hielt, jetzt galt‘s beizupflichten, jetzt galt‘s Augen-zu-und-durch, wohin ging ihr die Lebensfreude?
Also Broder, drängte Kristina. Ob er sich vor dem Abflug nicht lieber ein Stündchen hinlegen wolle, „nach all dem“?
Wenige Fragen später war Broschkus auf halbem Weg zum Hotel, leicht humpelnd, mit der Rechten auf seine Frau gestützt, in der Linken ein zerknüllter Zehnpesoschein, heftig brannte ihm der Mund.
Brannte derart,
daß er beim nächsten batido-Stand nicht lange zögerte, sie hatten schon etliche Gassen gequert, in denen man nicht mal einen Hund zu Gesicht bekommen, und nun gab‘s endlich etwas, das ihm die Zunge vom Gaumen lösen würde: Bananensaftmilchzuckerwasser, sozusagen, auf Eis.
Nein-danke, schüttelte Kristina den Kopf, in diesen batidos sei jede Menge Einheimisches drin, sie bleibe konsequent.
Einem Broschkus war das freilich egal und ein batido das einzige, das er in den vergangnen Wochen zu schätzen gelernt. Erst als er zwei rosarote Plastikbecher geleert hatte, bemerkte er, aber da passierten sie schon den Aufgang zur Kathedrale, wo einem die Bettler mit ihren Beinstumpen auflauerten, bemerkte er, daß er anstelle des Zehnpesoscheins einige Münzen in der Hand hielt.
Und in der Hand noch hielt,
während Kristina neben ihm lag, auf einem ausgeleiert wippenden Hotelbett, wo er sich in Ruhe fragen konnte, fragen mußte, warum das Mädchen ausgerechnet ihn um Wechselgeld angegangen hatte, zumal‘s doch vom Türhüter und im Grunde von jedem andern ohne die geringste Mühe –?
Durch die Sprossen der Fensterläden langte in langen Streifen das Licht des Südens, kaum abgedämpft drang ein beständiges Kreischen Quietschen Hupen Schimpfen Rufen, ein gellendes Pfeifen und plötzlich eine Sekunde der Stille – all das dumpfe Bebrüten des Mißlichen, wie‘s sich in Broschkus‘ Leben und, maßstabsgetreu verkleinert, auch in diesem Urlaub ausgebreitet hatte, nun wurde’s in einer einzigen Sekunde hinweggefegt, schlagartig war er wieder nüchtern: Daß man nur so dumm sein kann! Wie zart Kristina neben ihm lag mit ihren strähnchenhaft aufgerüschten, in Wahrheit vollkommen unblonden Haaren, wie ahnungslos zart und zerbrechlich, wie fern!
Entsetzlich sicher dagegen war sich Broschkus, gerade einen großen Fehler begangen zu haben: weil auf dem Zehnpesoschein des Mädchens womöglich all das zu finden gewesen, das er – vielleicht kein ganzes Leben, wohl aber die letzten Jahre ersehnt hatte, ein Name, eine Telephonnummer, ein Geständnis. Sogar die Matratze geriet ins Schwingen, so heftig ballte sich jetzt das Begreifen. Wie fremd und weiß und weich Kristina neben ihm lag, unerreichbar korrekt selbst im Schlaf, es war zum Heulen.
Doch diesmal dachte Broschkus gar nicht dran, sich seinem Mißmut hinzugeben, im Gegenteil, sondern machte den Fehler wieder wett. Jedenfalls hatte er das heftig vor, von draußen lärmte das Leben, von draußen lachte und lockte und rief ihn das Leben, schon war er selber draußen, entschlossen humpelnden Schrittes. Den Getränkestand fand er tatsächlich ohne das geringste Problem.
Sich einen weiteren Becher batido bestellend,
bat er die Verkäuferin, eine träg schlurfende Schwarze, die aus ihrem Wohnzimmerfenster heraus das Haushaltsgeld aufbesserte, bat sie mit einem energischen Zeigefingerkreisen, das Bündel Zehnpesonoten herauszugeben, das sie heut erwirtschaftet, dochdoch, ausnahmslos alle, ich zahle mit Dollars, bin Sammler. Als sie erst einmal kapiert hatte, wie diesem Verrückten geholfen werden konnte, war die Frau durchaus einverstanden, geistesgegenwärtig holte sie weitere Banknoten aus weiteren Zimmern, stets dabei nach Unterstützung rufend, am Schluß erhielt Broschkus sämtliche Zehnpesoscheine, die sie und ihre Nachbarn und die Nachbarn der Nachbarn auf die Schnelle hatten beibringen können.
Beschwingt begab er sich zurück zum Hotel, ein erkleckliches Bündel Papier in der Hand, das sich klebrig verschwitzt und ganz und gar großartig anfühlte.
Zur Überraschung seiner Frau trank er
im Flugzeug gleich einen doppelten Whiskey:
Also Broder. Was denn in ihn gefahren sei?
Tja, das wußte er zwar auch nicht so genau, aber im Grunde wußte er’s ziemlich genau, es fühlte sich aufregend gut an – auf dem Brustkorb, linksrechts, in der Leistengegend, linksrechts, selbst in der Gesäßtasche, Prost-Schatz.
Nach dem Essen nahm er weiteren Whiskey zu sich, wie angenehm dazu das Flugzeug summte, wie angenehm die Nachtbeleuchtung schimmerte, schließlich zog Kristina zwei Plastikkissen aus dem Handgepäck, um sie aufzupusten:
Also Broder. Daß er dermaßen erleichtert sei über das Ende dieses schönen kleinen Urlaubs, das fände sie leicht degoutant.
Indem sich Broschkus zur Toilette begab, mußte er sich fast an jedem Sitz festhalten. Als mit dem Zuziehen der Tür die Helligkeit aufflammte, erschrak er vor dem Kerl, der ihm da fahl und faltig aus dem Spiegel entgegen- und auch weiterhin schamlos zusah, wie er fassungslos seinen Adamsapfel betastete, dann aber mit siebzehn entschloßnen Händen Pesoscheine hervorzog, um sie sorgfältig eifrig gierig von vorn zu studieren und von hinten. Wie er dabei ein-, zweimal einen kleinen Triller abließ, ein drittes Mal schließlich, dabei galten die Triller nur irgendwelchen Kritzeleien auf den Scheinen, weißgott nichts Außergewöhnliches.
Weißgott nichts, ob er das gerade richtig gehört habe, nichts Außergewöhnliches?
Mit den drei Zehnpesoscheinen in der Hand befuchtelte Broschkus sein Spiegelbild, sein offensichtlich ahnungsloses Spiegelbild, sieh her, wenn du Augen hast zu sehen, das sind sie, ¡caramba! Mehr als erwartet sogar, mehr vielleicht als unbedingt nötig.
Weil sein Spiegelbild freilich nicht begreifen wollte, mußte er eine Spur deutlicher werden: Optionsscheine, Mann, das sind –!
Er tupfte dem Kerl im Spiegel mit den Spitzen seiner drei Scheine auf den Halsansatz: Eine Art außerbörsliches, ein verdammt außerbörsliches Termingeschäft, wenn du’s lieber so formulieren willst, das ist – was es denn da zu grinsen gebe?
„Einmal im Leben unlimitiert agieren, EIN MAL!“
Broschkus zuckte fast ebenso heftig zusammen wie sein Spiegelbild, war das wirklich eben er selbst gewesen, der seine Gesprächspartner sonst immer so sanft belehrte, in jahrelang antrainierter Leidenschaftslosigkeit? Wohingegen jetzt sogar die Dinge von ihm abrückten, nach rechts abhanden zu kommen drohten und nach links, wieso geriet hier eigentlich alles in Schieflage? Und wieso stanken die Scheine so sehr? Na gut:
„Einmal im Leben etwas Großes wollen, kapiert?“
Und nur noch geflüstert:
„Vor allem dann aber auch tun!“
Und nurmehr gedacht, ganz leise gedacht, weil sich die Dinge sonst vielleicht zu drehen begonnen hätten:
Wurde ja langsam auch Zeit.
Wie leicht sich die drei Scheine zum Verschwinden bringen ließen, wie leicht die restlichen Scheine von der Klospülung aus der Welt geschafft wurden, keiner hat’s gesehen, keiner hat’s gemerkt, adios.
Als er seinen Sitzplatz wiedergefunden hatte, entdeckte Broschkus ein aufgeblasnes Kissen, daneben eine halb schon in ihrer Halskrause eingeschlafne Frau, ach, das war Kristina:
„Also Broder! So betrunken hab ich dich lang nicht mehr erlebt.“
Bloß nicht antworten. Während sich Broschkus das Kissen umlegte, versuchte er, möglichst geradeaus zu lächeln – wie arm war alles, das er mit Kristina erlebt hatte! Wie arm war alles, das er ohne sie erlebt hatte! Bis auf das, bis auf das, bis auf das, was ihm nun in allen Muskelfasern und Haarspitzen und Nervenenden und in Form von drei Geldscheinen auch in seiner Brieftasche steckte, bis auf – Broschkus fühlte die Sehnsucht so sehr in sich aufrauschen, daß ihm die Ohren summten. Nicht mal den Namen des Mädchens wußte er, nicht mal ein-zwei-drei Silben, die man in sich hineinstaunen konnte. Kristina? Was wollte die denn noch? Oder war das die Stewardess, die eine Ansage machte, war das die sichtlich empörte Stimme der Stewardess? Die sich ein wenig mehr Respekt für die kubanische Währung erbat, „aus gegebenem Anlaß“, so wertlos sei sie auch wieder nicht, daß man sie einfach ins Klo werfen müsse, das verstopfe nur den Abfluß, vielen Dank. Spätestens jetzt lächelte Broschkus, träumend von einem Mädchen, das ihn mit Augen anblickte. Träumend von Augen, in denen ein Fleck war, und wie er so zurückblickte, im Traum, da sah er den Fleck auch auf ihrer Wange, auf der Oberlippe, dem Hals, da war der ganze Körper dieses Mädchens mit Flecken übersät, ein honigbrauner Leib mit schwarzen Flecken, ja: Lächelnd träumte Broschkus.
Textprobe auch in:
Hubert Winkels (Hg.): Beste deutsche Erzähler 2004. München (DVA) 2004.
Weitere Leseproben:
Nie wieder Deutschland. Abschiedsgesang des Herrn Broder Broschkus. In: Süddeutsche Zeitung, 9/1/04 …mehr
Das letzte Lächeln des Herrn Broder Broschkus. In: ADAC-Sonderheft „Hamburg“, 3/04
Das gestrichne Kapitel
15/05/2003
Das letzte Lächeln des Herrn Broder Broschkus
erschienen/erscheint in:
ADAC-Reisemagazin Hamburg, 3/04 (ursprünglich geplant als zweites Kapitel des Romans Herr der Hörner); in: Ralph Doege, Christiane Barnaházi, Jürgen Schütz (Hg.s): Perspektivenwechsel No 1/Julio Cortázar: Fantomas gegen die multinationalen Vampire und andere Erzählungen aus und über Lateinamerika. Wien: 2009. http://www.septime-verlag.at
Nie wieder gratinierter Walfischhoden auf Trüffelpüree,
nie wieder beheizbare Außenspiegel, nie wieder Deutschland!
Aus dem Haus ging Broschkus zur gewohnten Zeit, schickte von der Straße sein Lächeln zurück, in der Aktenmappe nichts als ein Spanischlexikon, ein Dollarbündel, ein Jugendphoto seiner kürzlich verstorbnen Mutter. Bis zum Abflug hatte er fast noch acht Stunden Zeit, einen Koffer voller Dinge zusammenzukaufen, im Vorbeigehen warf er das Handy in eine Mülltonne, erfreute sich an seinem Stecktuch, den Manschettenknöpfen und dem riesig ausgeleuchteten Himmel. Wie weit die Welt an solch stilvoll ausstaffierten Tagen selbst in Harvestehude scheinen konnte!
Als er, der Macht der Gewohnheit ein letztes Mal sich hingebend, am Jungfernstieg dem U-Bahn-Schacht entstieg, vorbei schon am Gesundheitshändler, den er in seinem früheren Leben Salatblätter für die Mittagspause hatte zusammenraffen lassen, und Schritt für Schritt weiter, dem unerhörten Ereignis entgegen, beschloß er, sich etwas zu gönnen: den Spaziergang zu gönnen, den er sich siebzehn Jahre lang verkniffen hatte, sobald der Blick, vom Bildschirm befreit, erst in die üppig weißen Seidenrosen fiel auf der Fensterbank, dann auf die Baumkronen draußen am Ballindamm und dann, in selten verlornen Momenten, auf die grauen Wasser dahinter, auf die geräuschlos gleitenden Schiffe der weißen Flotte und, vor allem, die riesige Fontäne, die aus all dem empor und in den Himmel schoß: Diesen Spaziergang, einmal um die Binnenalster herum, jetzt würde er ihn machen, als letzte Bestätigung seines längst in aller Heimlichkeit bereiteten Abschieds. Während ihm papierfarbene Frauen in Kostümen entgegenwogten und Sockenträger in Sandalen, lachend.
Nie wieder Männer, die jedem die Schulter klatschten, wenn sie einen Witz erzählt hatten, nie wieder Frauen in flachen Schuhen, die das mit Selbstbewußtsein verwechselten, nie wieder! Zeit war‘s, höchste Zeit.
Und da strich er auch schon am „Friesenkeller“ vorbei, wo den Kleinkundenkönigen (50.000 Euro Einlage, lachhaft!) von der SPARDA die Weltwirtschaftslage verkündet wurde, fast wäre er über einen Penner gestolpert, der mit Pappschild mitten im Fußgängerstrom saß, strich vorbei an den Schaufenstern des Schmuckhändlers, dem er vor fast fünfzehn Jahren Verlobungsringe abgekauft hatte, aus einer Laune heraus, gewiß, da war er noch Sachbearbeiter mit kleiner Handlungsvollmacht gewesen, aber wenige Schritte später, endlich hatte man ihn zum stellvertretenden Abteilungsdirektor ernannt, da stand er vor den Fenstern des nächsten Juweliers, oh, dort war damals ein Paar unpassend teurer Hochzeitsringe zu sehen gewesen. Noch hinterm Alsterhaus durfte er ganz unverhohlen lächeln, einem Akkordeonspieler warf er einen Euro zu, aus der Querstraße leuchtete die Turmspitze des Michels, aus der Passage vom Hamburger Hof drangen die gleichmäßig desinteressierten Herumtapsereien eines Jazzpianisten.
Schon wieder ein Juwelier.
Und noch einer, meine Güte. Welch eine Fülle an Frauen, mit und ohne Einkaufstüte, blond bis ins Knochenmark. Mit einem letzten Blick Richtung Gänsemarkt lächelte sich Broschkus in den Neuen Jungfernstieg hinein, in weitem Bogen um den Alsterpavillon herum, wo er bis vor kurzem Tortenstücke vertilgt hatte, vorzugsweise mit mißtrauischen Witwen, die alles besser wußten. Im Gegensatz zu seinen jüngeren Kollegen verfügte er just über jenen Grad an Korpulenz, der von seinen Kunden als seriös empfunden wurde, da hatte er noch von „baldiger konjunktureller Erholung“ schwärmen dürfen, wo andre längst zur Flucht ins Festverzinsliche drängten, und auch hausintern hatte er noch eine ganze Weile davon gelebt, daß er (und seine nach außen sehr konservativ sich gebende Transaktionspolitik) ein Leben lang unterschätzt wurde. Wahrscheinlich weil er sich aus dem Tagesgeschäft hochgedient hatte, ein fleißiger Praktiker ohne Hang zum Visionären, vielleicht auch weil er sich selbst als Leiter der Wertpapierabteilung nicht zu schade war, die Assistenten seiner Kunden zum Essen einzuladen und ihren Sekretärinnen Geburtstagssträuße vorbeizubringen. Zugegeben, noch nach der Jahrtausendwende hatte Broschkus nicht schlecht gelebt, zwischen englischen Spanntapeten, auf denen man zur Jagd blies, einem stummgeschalteten ntv-Programm mit den durchlaufenden Notierungen, der Reuters-Homepage und einem verschachtelten Excel-Dateiensystem – bis dieser Crash auf Raten begann, dieser über Jahre sich hinziehende Untergang der gesamten IT-Branche und schließlich auch der Old Economy, sogar in diesem Jahr noch hatte er sich fortgesetzt, ein historischer Tiefststand nach dem andern, Weltenende. Wenn man’s freilich ganz genau bedachte, so war Broschkus‘ eigner Untergang schon eine Weile zuvor eingeläutet worden, auf dem Höhepunkt der Hausse Ende der neunziger, als er sich hatte überreden lassen, in großem Stil beim Neuen Markt zuzugreifen, bei fernöstlichen Internetwerten, bei russischen Ölfirmen und … bei weiteren Verbrecherpapieren, wie er jedem erklärte, der’s nicht hören wollte, zu einer Zeit der zweistelligen Renditeerwartung, da er seine Kunden gern zum Champagnertrinken auf einer Segelyacht oder beim Hamburger Derby eingeladen, nicht zum Schaden von Hase & Hase.
Ein letzter Blick dann gleich wieder nach links, in die schräg abzweigende Häuserflucht der Colonnaden, an deren anderem Ende er seit einem knappen Vierteljahr Spanisch gelernt hatte, Kurs auf Kurs und den Rest der Zeit in umliegenden Cafés, Hausaufgaben verfertigend, Vokabellisten. Während Kristina geglaubt hatte, er ginge ins Büro wie eh und je, schlüge sich mit seinen beständig ins Bodenlose fallenden Verbrecherpapieren herum und ebenso beständig lockenden Gewinnen bei Leerverkäufen, denen er Anfang vorigen Jahres in seiner Not nachzujagen begonnen, verstärkt schließlich dann auch mit Turbo-Zertifikaten zwecks Abwärtsspekulation auf diverse Indices: zum Wohle seiner Kunden, wohlgemerkt, zum Wohle nicht zuletzt auch der Hase & Hase KG.
Gut, daß er Kristina vor Jahren schon überzeugt, während der Bürozeiten gar nicht erst zu versuchen, ihn anzurufen, sehr gut. Über den Jahreswechsel war er gerade noch mit seinem Lieblingstrick gekommen, Spekulationsverluste realisierend, ab dem 7. Januar aber bereits, dem Tag nach seiner Rückkehr ins Tagesgeschäft, dieselben Papiere sanft zurückkaufend – so daß er den Anlegern das Gefühl geben konnte, ihre Verluste seien im Grunde nur halb so schlimm, schließlich beteilige sich der Fiskus daran. Wobei die Vision auf zukünftigen Gewinn ja gewahrt blieb; dann aber, Anfang März, mußte er sich vom Niederlassungsleiter in gedämpftem Tonfall belehren lassen, man habe soeben mit dem Regionalbereichsleiter Nord gesprochen. Jahrelang habe man Broschkus ja sehr gefördert, und es schmerze nicht wenig, daß man nun seinen Lieblingsprokuristen – der Niederlassungsleiter sagte seit je „mein Lieblingsprokurist“ – so herb abstrafen müsse, doch der neue Partner in Frankfurt fürs Privatkundengeschäft gebe nun mal seine Prinzipien vor. Ja, abstrafen müsse, das habe Broschkus richtig gehört: Ausgerechnet seine älteste Stammkunden hätten sich zusammengetan, anscheinend schon seit dem vorjährigen Hase & Hase-Golfturnier, und nun mit einer Klage gedroht, einer Klage auf Schadenersatz. Über zweieinhalb Millionen hätten sie insgesamt verloren aufgrund höchst spekulativer, ja dubioser Engagements, wie sie sich ausdrückten: Warum ein erfahrner Mann wie Broschkus sie nicht wenigstens davor gewarnt hätte, wenn er die Research-Vorgaben schon so eigenmächtig hinterging? Ausgerechnet Broschkus, der bei den Frankfurtern – der Niederlassungsleiter sagte seit je „die Frankfurter“ – stets als konservativ, fast als ein wenig zu konservativ gegolten habe, zu vorsichtig, zu unaggressiv? Aber ehe der auf seine Telephonmitschriften verweisen konnte, wurde bereits genickt, jaja, es sei eine loyalitätsarme Zeit, schlechte Performance rechtfertige jede Art von Vertrauensbruch, trotzdem müsse man die Vorgänge natürlich an die Revision geben. Schließlich habe Broschkus nicht nur hausinterne Auflagen … und zwar systematisch … seit annähernd einem vollen … mißachtet, sondern auch … Ob er anstelle der Abmahnung nicht eine Abfindung vorzöge?
Dabei hab‘ ich doch alles richtig gemacht! schwieg Broschkus. Spätestens zum Verfallstermin am Monatsende, wenn seine Maßnahmen endlich griffen, jede Wette, würde man sich wieder einmal kistenweise mit Bordeaux bei ihm bedanken! Und erst recht, zugegeben, wenn er letzthin, bei der Order auf chinesische Optionsscheine, nicht „unlimitiert“ gesagt hätte, „ein Mal im Leben unlimitiert agieren, verstehen Sie?“ Was konnten seine Gesprächspartner, was konnte der Niederlassungsleiter, was konnte die Zentrale in Frankfurt denn wissen von all den honigbraunen Gedanken, die ihm seit seiner Rückkehr aus Kuba zwischen die Kalkulationen fuhren und vor die Hochrechnungen, was konnten sie auch nur ahnen davon, daß er in solchen Momenten des Erschauerns die vorbeiflimmernden Zahlenkolonnen nicht mal mehr ordentlich zu entziffern wußte, geschweige zu interpretieren, weil seine Welt gerade von einem grünen Leuchten überstrahlt wurde, von abgründig grünem Leuchten mit einem schmalen braunen Strich darin, einem Sprung oder eigentlich Fleck? Daß er dann, anstatt den Schwankungen hinterm Komma ihre Geheimbotschaften zu entreißen, daß er dann aufpassen mußte, von diesem Sprung in der Welt, von diesem Abgrund nicht verschlungen zu werden und schnell nach verschwitzten Zehnpesoscheinen greifen oder seltsam vergebliche Ferngespräche tätigen oder von gefleckten Leibern träumen mußte, vom GANZ ANDEREN, wenn er einmal deutlich werden durfte: Herr Doktor Broder Broschkus, der siebzehn Jahre lang nur für seine Stammkunden gelebt hatte, immer öfter war ihm der Blick über die Seidenblumen gerutscht und durch die Baumkronen aufs Wasser, zu oft, um in diesen unruhigen Zeiten Fehler zu vermeiden, Fehlentscheidungen, entscheidende Fehlentscheidungen.
Der Rest war Selbstabwicklung gewesen und eine Angelegenheit von Monaten. Wer weiß, ohne die Verschwörung seiner Hauptklienten hätte er den Absprung vielleicht gar nicht geschafft, als bloßer Aussteiger wäre er sich seit je unglaubwürdig vorgekommen, nein, dazu verlief sein Leben hier viel zu angenehm geordnet und viel zu angenehm unaufgeregt. Nun aber war‘s plötzlich wieder ernst und heftig geworden, das Leben, nun aber galt es, den Entschluß, den er bereits auf dem Rückflug von Santiago gefällt und dann Tag für Tag verschoben, revidiert, verworfen und erneut gefaßt hatte, Nacht für Nacht, nun galt es, den Entschluß auch endlich umzusetzen. In aller Konsequenz. Und ohne falsche Sentimentalitäten, wie er’s von seinen Kollegen aus der Kreditabteilung kannte, wenn sie mal wieder eine Firma liquidierten. Wobei er weiterhin jeden Morgen das Haus so pünktlich verließ, daß Kristina keinen Verdacht schöpfen konnte.
Nie wieder ungedeckte Calls, nie wieder Exotenpapiere, nie wieder Window-Dressing zum Jahresende! Nie wieder Trennkost, Vollkasko, Frühwarnsysteme!
Ach, Kristina. Hoffentlich hatte sie ihn wenigstens die letzten Jahre betrogen, nach dem Ende der Gesprächsversuche. Anstatt bloß klaglos zu verblühen in all ihrer Broschen- und Perlenketten-Perfektion, immer schmaler war sie im Lauf der Jahre geworden, immer durchsichtiger – ein bißchen weniger Geigenspiel hätte ihr gewiß gutgetan. Aber nein, noch im Nachtgewand verbreitete sie diese hermetisch inszenierte Geschlechtslosigkeit, und erst im Schlaf, wenn sie die Kontrolle über ihre Gesichtszüge verloren, zerfloß all ihre kühl abweisende Eleganz in etwas, das er einmal sehr geliebt hatte: Schon lang hatte Broschkus verzagt an ihr und jeden Versuch, sie zu berühren, eingestellt – schon lang wäre er reif gewesen und nun war er’s wirklich, reif für die Obsession.
Wie grün die Hapag Lloyd-Dächer herüberschimmerten von der andern Alsterseite, im Gegenlicht das Wasser ein blendender Glanz, weiß stäubte die Fontäne, auf den Dachfirsten stramm standen die Fahnen im Wind. Fast hätte er das Fenster seiner Lieblingssekretärin dort drüben erkennen können, einen Stock indes zu niedrig lag es, abgeschirmt von Baumkronen. Schräg darunter, vertäut seit Jahr und Tag und deutlich zu sehen: war das kleine Caféschiff, in dem er’s nie geschafft hatte, eine Pause einzulegen. Weiter!
Vorbei an klassischer Mode, an Antiquitäten, an den locker besetzten Tischchen des „Condi“, wo bereits die Porsches parkten, dazwischen ein Rolls Royce, ein Jaguar, sämtlich in Schwarz, vor dem Haupteingang des „Vier Jahreszeiten“ schubste ihm ein entgegenrollernder Skateborder fast das Lächeln aus dem Gesicht, fast: Wie sie damals vorgefahren waren, in einem verrosteten Renault, direkt vom Standesamt, direkt hierher an den Rand des roten Teppichs, und wie Kristina dann dem Portier die Wagenschlüssel überreicht und der noch nicht mal mit der Livree gezuckt hatte – ja, das war‘s gewesen, damals, und der Rest des Tages ein einziges Kuchenessen und Cocktailtrinken und Hinausblicken aufs Wasser, bis die Lichter rundum aufflammten, die Neonkonturen des Alsterhauses, die schummernden Fensterlampen des Alsterpavillons, bis sie schließlich ganz von innen heraus strahlte, die Stadt und die Nacht und die Welt, damals.
Jajajaja, noch immer konnte sich Broschkus daran berauschen, doch nicht mehr aus voller Seele. Etwas Braunes war ihm vor all die honorigen Herrlichkeiten geraten und machte sie fad und flau, etwas Honigbraunes, etwas höchst Biegsames, das nach Fleisch roch und einen Fleck hatte im Auge, etwas, das … nicht mal einen Namen hatte.
Erst als die wohlvertraute Fassade des Übersee-Clubs vor Broschkus auftauchte, wo er mehrfach die Woche mit seinen Kunden (ab fünf Millionen aufwärts) zu Mittag gegessen, fand sein Schritt wieder fest geradeaus, unter den Bäumen rollten Zeitungsseiten, dahinter knallten für ihn schon die Fahnen, und von dort hatte man dann diesen Blick: Oh, das war schön, gewiß das Schönste, was man von einer deutschen Großstadt erwarten durfte. Unten am Ufer schwärmte Broschkus nun dahin, graphitgraue Enten auf den Wellen, weiß die Schipperboote linksrechts der Fontäne, von hier aus hatte man das gesamte Prachtareal aus Wasser und steingewordner Macht vor sich entfaltet, ein helles Leuchten heute, darüber die Grünspandächer mit ihren Reederei- und Hamburg- und Deutschlandflaggen, verstreut ein paar Kirchturmspitzen, und dann den riesigen Himmel, ja, den vor allem mit seinen schnell treibenden Wolken. Davon würde man demnächst nur träumen können, welch ein gewaltig weißes Wolkentreiben, welch eine Luft, und trotzdem:
Nie wieder Risikobegrenzung, Rückversicherung, Renditeberechnung – oh, es wurde Zeit. Nie wieder Ersatzkrawatte im Büro, nie wieder Ersatzgeliebte im Hotel, nie wieder Ersatzbefriedigung beim Downloaden, nie wieder!
Dort, wo die Bootsdurchfahrt zur Außenalster war, stieg Broschkus hinauf zur Lombardsbrücke, gerade fuhr eine S-Bahn Richtung Altona und erzeugte wunderbar unaufgeregt ein Klackern, schon stand er an der Einmündung des Ballindamms, blickte aufs weißgewürfelte Museum der Gegenwart, hinter dem die Kuppel der Kunsthalle aufschimmerte, und dann stand er nicht mehr, sondern bog entschlossen ab. Bog in die Straße, die er siebzehn Jahre lang entlanggelaufen, stets in Sorge, die Kurse würden fallen, wenn er sich zu lang vor einem der Schaufenster aufhielte, würden steigen, wenn er gar einen Braunen im „Café Wien“ einnähme, wie‘s absurderweise hieß, das Caféschiff. Welch eine Fülle an Herren in gedeckten Tönen, mit und ohne Aktenmappe, den Krawattenknoten zum Teil schon fest mit dem Adamsapfel verwachsen, und zwischen Krohns Einrichtungsgeschäft und den „Classic luxuries“ von Goodmann Grant tauchte er dann, sehr dezent, tauchte auf, der leicht zurückgesetzte Eingang von Hase & Hase, und – Broschkus blieb nicht einmal stehen.
Nie wieder vornehm und von oben herab, nie wieder Ton in Ton, nie wieder indigniert und schweigend – es war Zeit, höchste Zeit.
Vorbei an der „Ciu‘s“-Bar, in dessen klobiger Gehsteigbestuhlung er bunte Flüssigkeiten für seine Lieblingskunden geordert hatte, vorbei an einem Souterraingeschäft mit Porzellanputten, ein japanischer Zierfischhund mit Segelohren stand für 1671 Euro in der Auslage, vorbei. Denn von vorne leuchtete jetzt das Rathaus mit seinem riesigen Turm, ja, das strahlte etwas aus, das war etwas, durchaus; von vorne aber leuchtete vor allem, zwischen den Bäumen, die Anlegestelle des „Café Wien“, beschwingt lächelte sich Broschkus über die Straße. Und tat endlich das, was er nie getan: lächelte lächelte lächelte sich übern Steg, gleich würde er die Tür mit seinem bloßen Lächeln aufdrücken, gleich würde er sich einen Braunen bestellen, einen kleinen Braunen, und während Kristina ahnungslos in ihrer homöopathischen Praxis Hundekrankheiten kurierte, würde er sich von all dem Aufgebot an Schönheit nicht länger täuschen lassen: Was es an Glaube, Liebe, Hoffnung hier zu verlieren gab, das hatte er verloren.
Nie wieder mit Senatorengattinnen beim Butterkuchen parlieren, nie wieder mit Vizepräsidentinnen über Wohltätigkeit räsonnieren, nie wieder deutsche Frauen – schon ihre Namen taugten nicht, geflüstert zu werden: Nie wieder Deutschland!
Pressestimmen
“Der Roman ist ein Feuerwerk an Komik und Ironie, mit der die sinnlich-drastischen Schilderungen der oft blutigen Zeremonien, brutalen Hahnen- und Hundekämpfe, Hausschweinschlachtungen und grausigen Tieropfer gewürzt sind. Die Straßenszenen in Santiago verströmen Vitalität und derbe Lebensfreude bis ins kleinste Detail. (…) Da M. Politycki von der Kritik überwiegend hochgelobt wird, empfiehlt sich die Anschaffung bereits ab mittleren Bibliotheken.”
(Dagmar Härter, ekz-Informationsdienst, Jan. 06)
„Wenn auch im exotischen Gewand, variiert Politycki den alten ‚Faust‘-Stoff und verpflanzt die Geschichte vom Pakt mit dem Teufel in den dunklen Süden Kubas.”
(Thomas Kraft, Rheinischer Merkur, 12/1/06)
“nichts für zarte Gemüter und selbst hartgesottene Leser dürften am Ende erleichtert aufatmen, daß sie dem Teufel noch einmal entronnen sind”
(Stadtanzeiger Neustadt an der Weinstraße, 5/1/06)
„ein spannender, schockierender, schweißtreibender Lesestoff (…). Matthias Politycki gelingt es nicht nur, den Geruch Kubas in Worte zu fassen, sondern auch den Leser in den Bann des Bösen zu locken
(MDR/FS, artour, 24/1/06)
„ein streckenweise sehr spannender und witziger Antibildungsroman“
(Sebastian Fasthuber, Falter/Wien, Nr. 3/06)
„eine beeindruckende Demonstration seiner Sprachgewalt
(Niederösterreichische Nachrichten, Woche 04/2006)
„Etliche Monate hat Politycki auf der Insel Fidels verbracht, und er scheint sie bis aufs letzte Küken, das in irgendeinem Hinterhof einer Vorstadthütte vor sich hin pickt, zu kennen. (…) Aber während wir uns noch verwirrt fragen, wie wohl die kubanische Originalversion dieses 730-seitigen Textes lautete, hört sich das Ganze längst nach der venezianischen Himmel-und-Höllen-Fahrt eines Gustav von Aschenbach an; nur daß es sich diesmal nicht um einen Münchner Künstler handelt, sondern um einen Hamburger Banker. (…) Der Verfasser von ‚Herr der Hörner‘ hat damit, nach einer fünfjährigen Pause, einen neuen Roman vorgelegt, der ihm den Titel ‚Herr der Bücher‘ sichert. In elegisch-ironischen Rhythmen reiht sich Leitmotiv an Leitmotiv. Nonchalantes Neudeutsch mischt sich mit altväterischem Aktendeutsch und das Zitat aus der Weltliteratur mit O-Tönen aus der Karibik. Aus alledem komponiert Matthias Politycki einen satten son mit samtenem Sog: (…) Selten hat ein reisender Romancier heute das Andere und das Eigene so scharf angeschaut – und das Anschauen dazu – wie der 50-jährige Münchner: ein Fanfarenstoß auf den Herrn des schwarzen Humors. (…) In seinem Santiago de Cuba trommeln die Santos und die Salseros. Und in seinen Lesern pocht die Lust, die Leselust.“
(Alexandra Kedve, Neue Zürcher Zeitung, 17/1/06)
„eine explosive Mischung, die in der Literatur schon vielfach durchgespielt wurde (…). Der Zivisationsfirnis beginnt rasch abzublättern, und diesen Prozeß zeigt Politycki mit großer kompositorischer Meisterschaft. (…) Zusammengehalten werden die verschlungenen Wege der Handlung mit den vielen dunklen Figuren und Praktiken von einem festen Gerüst aus Motiven und Sprachschleifen, die eine Art Netz ergeben, in dem Broders zivilisiertes Ich Schicht um Schicht verschwindet. (…) Politycki hält die Spannung bis zuletzt durch.“
(Evelyne Polt-Heinzl, Die Presse/Spectrum, 17/12/05)
“700 gewaltige Seiten bis zum furiosen Ende – nicht leicht zu lesen, aber unglaublich faszinierend.”
(Klaus-Georg Loest, Westfälisches Volksblatt, 17/12/05)
“Polityckis Sprachthythmus, Ironie und Menschenkenntnis (sind) unwiderstehlich.”
(Claudia Ihlefeld, Heilbronner Stimme, 14/12/05)
„Nach so viel Ostalgie und deutscher Innerlichkeit: Endlich mal ein Autor, der in die Welt rausgeht und was erlebt. Bildstark erzählt und geprägt vom Sound Kubas.“
(Peter Hetzel, SAT 1/Frühstücksfernsehen, 13/12/05)
“hat mit einer touristengerechten kubanischen Folklore à la ‚Buena Vista Social Club‘ nichts am Hut”
(Markus Bundi, Wiener Zeitung, 9/12/05)
„eine opulente Sprachschlacht, ein gewaltiges Werk für tapfere Leser (…), ein leidenschaftliches, ein grausames, vor allem aber ein sinnliches Buch. Man schmeckt das Salz der Erdnüsse auf den Lippen, spürt den Staub in der Kehle, riecht das Bratfett der erlegten Sau und das getrocknete Blut auf den okkulten Ketten, fühlt das ranzige Pizzaöl an den Fingern und die Sonne auf der Haut. Und schwärmt das nächste Mal jemand vom Kuba-Urlaub, wird der Leser höchstens beiläufig lächeln. Er ist schließlich in Santiago gewesen.“
(Maike Schiller, Hamburger Abendblatt, 10/12/05)
„Diese schwülheiße Literatur hilft perfekt gegen Winterdepressionen.“
(Hamburger Morgenpost, 8/12/05)
„Ein monumentaler Bildungsroman (…). Sein Handwerk beherrscht Matthias Politycki. Er pflegt seinen gewohnt rhythmischen Erzählstil und versorgt uns mit bildhaften Schilderungen des kubanischen Alltagslebens. (…) Allein dieser kubanischen Impressionen wegen lohnt sich die Lektüre. (…) Als ein mit allen Wassern der Postmoderne gewaschener Schriftsteller baut Matthias Politycki natürlich eine Sicherheitsbremse ein: Dadurch, daß er Broder nicht selbst berichten läßt, sondern dessen innere Monologe immer wieder durch eine auktoriale Stimme konterkariert, arbeitet er mit distanzierenden Effekten.“
(Maike Albath, Frankfurter Rundschau, 7/12/05)
„Was zunächst wie die banale Liebesgeschichte eines saturierten Fünfzigers aussieht, erweist sich am Ende als ein Roman vom Zusammenprall der Kulturen.“
(Rainer Kasselt, Sächsische Zeitung, 5/12/05)
„so gut wie ein Flugticket“
(Elle, Nr. 12, 2/12/05)
„spannend, opulent und sprachbesessen, sehr genau aber auch witzig erzählt“
(Tomas Gärtner, Dresdner Neue Nachrichten, 1/12/05)
„Nach 200 Seiten ist sogar das moralische Entsetzen verschwunden.“
(Bücher, Dez. 05/Jan. 06)
„Politycki erzählt in einer fein gedrechselten Sprache, die ironisch gebrochen bleibt. Und eben diese Kunstfertigkeit wird zum Problem: Der Held verfällt zunehmend dem Irrationalen, dem Rausch – der Erzählstil bleibt gediegen. So scheitert dieses üppige Buch, aber es scheitert grandios. Und das ist mehr, als man von all der Befindlichkeitsliteratur hierzulande sagen kann.“
(Kultur News, Dez. 05)
“Matthias Politycki vermeidet es, sein Leser über mehr als 700 Seiten mit autobiographischer Selbstbespiegelung zu langweilen. Vielmehr ist ihm mit dem neuen Roman das am überzeugendsten gelungen, was ihm lange als spezifisches künstlerisches Ideal seiner Generation vor dem geistigen Auge stand. (…) Eine politische Haltung durchscheinen zu lassen in einem Text, der primär das zutiefst Menschliche zum Gegenstand hat, ist sein Hauptanliegen. Der ‚Herr der Hörner‘ leistet dies in einer bislang nicht dagewesenen Konsequenz.”
(Macondo, Dez. 05)
“Matthias Politycki macht die unbequeme Gegenwart zum Zentrum seines Erzählens, denn in Wirklichkeit wendet sich Broschkus von einer Kultur ab, der auf alarmierende Weise die Basis ihres kulturellen Selbstverständnisses abhanden gekommen ist. Trotz allem versteht es Politycki, das ohne erhobenen Zeigefinger zu erzählen. Die Sichtung der untergehenden Welt ist vielmehr gepaart mit hämmernd-rhythmischen Sätzen, die einen durch den Roman eilen lassen, daß es einem, wenn nicht gar schwarz, so vielleicht honigfarben vor Augen wird.”
(Heiko Neumann, Rezensöhnchen. Zeitschrift für Literaturkritik, Dez. 05)
„Der Autor muß und will die magische Welt mit den Stilmitteln der westlichen Literatur erzählen, mit strengem, bis ins Manierierte reichendem Form- und Sprachbewußtsein. Damit steht die magische Welt einem Hubert Fichte – der die Distanz zu den afroamerikanischen Riten nie aufgegeben hat – näher als einem Gabriel Garcia Marquez, der mit Form, Sprache und Inhalt ganz in die magische Welt abtaucht.“
(Otfried Käppeler, Südwest Presse, 30/11/05)
„Midlifecrisis, das (…) ist ein Spiel mit dem Feuer. Und ein Pakt mit dem Teufel. (…) Nicht anders bei Matthias Politycki, einem der sprachlich potentesten Autoren hierzulande. Politycki ist ein Pfundskerl – einer, der stilistisch mit feiner Klinge ficht, doch sich gerne dort tummelt, wo die Säbel rasseln. Rasant erzählt er von den Wegesrändern. Weil es am Saum zumeist am schönsten ist. (…) ‚Das Helle vergeht, doch das Dunkle, das bleibt.‘ Wie ein roter Faden zieht sich diese Farbenlehre durch Polityckis Konvolut, das mit enormem Stilwillen erstaunlich konzentriert durchgearbeitet ist; das mit seinem bisweilen burlesken Ton all die morbiden Mythen angemessen ins ironisierende Licht rückt. (…) ein Mordsbuch. Politycki beherrscht einen Ton, der weder Tod noch Teufel scheut. Das ist bemerkenswert in unserem verzagten Land.“
(Lars Grote, Märkische Allgemeine, 29/11/05)
„spannend“
(Madame, Nr. 12, 28/11/05)
„eine geradezu magische Reise in die Karibik (…). Sprachlich gelingt es Matthias Politycki meisterhaft, das kubanische Klima in Worte zu fassen. (…) ‚Herr der Hörner‘ ist ein großes Stück Literatur und geht in seiner Absicht und Wirkung weit über das Erzählend-Unterhaltende hinaus. Matthias Politycki spiegelt hier Grundsätzliches und stellt damit eingefahrene und scheinbar auch bewährte Lebenskonzepte radikal in Frage.“
(Andreas Thiemann, Westfalenpost, 24/11/05)
„bietet eine ganze Welt. (…) Ein großer erzählerischer Ansatz, der nach Grundwerten des Lebens sucht.“
(MDR/Figaro, 22/11/05)
„Er zählt zu den Weltreisenden der deutschen Literatur und zu den wenigen Autoren, die über eine ganz eigene Sprache, einen unverkennbaren Sound verfügen: Matthias Politycki. (…) ‚Herr der Hörner‘, sein neuer Roman, erzählt mitreißend von einem weißen Mann in einer schwarzen Kultur, ein deutscher Banker begegnet Teufelsanbetern auf Kuba (…) – eine radikale Absage an die Kubaklischees des Buena Vista Social Club, (…) eine tolle Geschichte über einen Mann, der ins Herz der Finsternis blickt.“
(Denis Scheck, ARD/druckfrisch, 20/11/05)
„Matthias Polityckis Roman ‚Herr der Hörner‘ (…) ist famos gelungen. (…) Gleichsam Arm in Arm mit Hemingway und Joseph Conrad, Coppola und Crumb taumelt der Erzähler durch kinotauglich scharf ausgeleuchtete Szenen und Visionen. (…) ‚Herr der Hörner‘ ist ein Roman, der in die Nase sticht, in den Ohren nachhallt und in den Augen beißt. Zum Ende hin nehmen die Beschreibungen von diversen afroamerikanischen Voodoo-Ritualen gruselige Ausmaße an. Schweißtreibender Lesestoff, fürwahr, aber die deutschsprachige Literatur dieses Herbstes hält ja genug trockene Geschichten bereit.“
(Hajo Steinert, Tages-Anzeiger, 18/11/05)
„Phantastischer Lesestoff – nicht nur für Kuba-Fans.“
(Ludwigsburger Wochenblatt, 17/11/05)
„In äußerst ironischem Gegensatz zum artifiziellen, ziselierenden Stil Polityckis läßt Broschkus sich, anfangs noch täppisch und schüchtern, dann umso genußvoller in das lärmende, brutale Alltagsleben Kubas fallen. (…) Wie ein verhinderter Abenteurer den Ballast eines beschwerlichen Wohllebens abwirft, erzählt dieses dicke Opus.“
(Christine Diller, Münchner Merkur, 17/11/05)
„eine der interessantesten Neuerscheinungen dieses Bücherherbstes (…). Sprachfetischist Politycki (…) pflegt komplexe Plots.“
(Claudia Ihlefeld, Heilbronner Stimme, 15/11/05)
„Damit ist Matthias Politycki in seinem neuen Roman das am überzeugendsten gelungen, was ihm lange als spezifisches künstlerisches Ideal seiner Generation vor dem geistigen Auge stand. (…) Eine politische Haltung durchscheinen zu lassen in einem Text, der primär das zutiefst Menschliche zum Gegenstand hat, ist sein Hauptanliegen. Der „Herr der Hörner“ leistet das in einer bislang nicht dagewesenen Konsequenz. (…) Sprachlich ist der auch als Lyriker erfolgreiche Autor im „Herrn der Hörner“ auf der Höhe seines Könnens, und wer bei der Lektüre über die eine oder andere leicht manieristisch wirkende Eigenheit der Sprache Matthias Polityckis stolpert, der lese die entsprechende Passage laut, um zu erleben, wie intensiv der Politycki-Stil durch einen geradezu musikalischen Sprachfluß geprägt ist.“
(Arnd Richter, WDR 3/Gutenbergs Welt, 13/11/05)
„Polityckis langer und dichter Roman ist mehr als ein ‚cherchez la femme‘ (…): Ein Entwicklungsroman als westeuropäische Variante des phantastischen Realismus, in Polityckis mitreißendem Sprachrhythmus aus beiläufiger Beobachtung, Ironie, Reflektion und Menschenkenntnis.“
(cid, Heilbronner Stimme, 8/11/05)
„Dieses Buch ist ein Rausch, sprachlich wie inhaltlich.“
(Markus Bundi, Mittelland Zeitung, 4/11/05)
„Welch ein Fundus an Beobachtungen und Details! Allein für die Materialsammlung wäre der Autor zu loben. Aber der Roman ist mehr als das Ergebnis einer fundierten Recherche: eine Mischung aus Höllentrip und Gralssuche, Verheißung und Verderben – und ein formbewußter, mit Ironie und starken Bildern souverän hantierender Roman des 21. Jahrhunderts, der den Bogen über Zeiten und Welten zu schlagen versteht.“
(Thomas Kraft, Financial Times Deutschland, 4/11/05)
„Der da schreibt, weiß, wovon er erzählt. (…) Die Vernunft gerät dabei zusehends ins Hintertreffen, die Unmittelbarkeit aber drängt sich nicht nur Broschkus, sondern auch den Leserinnen und Lesern zunehmend auf. Lebensfreude und dunkle Magie gehen in diesem großen Roman Hand in Hand, ein Grundkurs in Spanisch ist quasi inklusive.“
(Markus Bundi, Aargauer Zeitung, 4/11/05)
“Politycki gelingt es, mit dem steten Wechsel von Tempo und Stillstand, Emotion und Anschauung und einer barock überbordenden und doch genauen Sprache den Leser in den Bann zu schlagen.“
(Thomas Kraft, Hannoversche Allgemeine Zeitung, 2/11/05)
„ein harter Brocken“
(Neue Presse Hannover, 1/11/05)
„‚Herr der Hörner‘ ist für mich eine (fast schon religiöse) Offenbarung, der Beweis, daß Erzählkunst nach wie vor existent ist. Der Zauber der Worte, verpackt in einem Roman, den ich ab sofort zu den großen der jüngeren Literatur zähle. Die Rasanz des Werkes beginnt mit der Namensgebung für den Protagonisten (…): Broder Broschkus. Politycki reiht sich damit ein in die Phalanx begnadeter Autoren, die die Personen ihrer Romane nicht mit belanglosen Namen diskreditieren. (…) Mit einer unglaublich barocken Wortfülle erschließt der Autor die Insel (…) wie ein Puzzle, (…) erkennbar in dem Moment, wenn zwei weitere Teile zusammenpassen, um das große Ganze Stück für Stück fühlbar zu machen (…) – Matthias Politycki in einem Schreibrausch. (…) Dabei bewahrt der Erzähler durch feinsinnigen, die Handlungen hinterfragenden Humor die notwendige Distanz.“
(Andreas H. Schneider, Das Wortreich Online, 1/11/05)
„Ein schockierend authentisch wirkendes Buch, das an der Aufklärung zweifeln läßt.“
(Playboy, Nov. 05)
„Mit sprachmächtiger, geradezu prunkender Erzählweise gelingt es Politycki, ein unbekanntes Kuba auf höchst sinnliche Weise erfahrbar zu machen. Ein opulent ausgestattetes Werk, für mich der Roman des Jahres.“
(H.O., Bielefelder/Buch des Monats, Nov. 05)
„Eine fesselnde Geschichte von der Sehnsucht nach dem wirklichen Leben, der engen Beziehung zwischen Göttern und Menschen sowie der täglichen Mühe, im Alltag von Fidel Castros Kuba zu bestehen.“
(http://www.daserste.de/druckfrisch/thema_dyn~id,106~cm.asp Nov. 05)
„Atemberaubend spannend!
(Inge Kracht, Rheinische Post, 22/10/05)
„Politycki schafft es wie nur ganz wenige Autoren, Denken der Figur und Erzählen parallel zu schalten. Und deshalb begleitet man Broschkus bei seinem unaufhaltsamen Gang gern, in alle Dunkelheiten und Alpträume – bis zu seinem Untergang.“
(Markus Bundi, Südkurier, 24/10/05)
„Matthias Politycki erregt Neugier auf Exotisches (…). Der Münchner Autor beherrscht die Kunst, durch winzige Andeutungen Spannung zu erzeugen.“
(Adolf Fink, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22/10/05)
„Auch wenn in der Konfrontation [seiner Hauptfigur] mit dem Gehörnten Furcht wie Anbetung vorkommen und allerhand blutige Rituale, es geht dem Autor um Aufklärungskritik. Um das Kontrastprogramm zwischen der Müdigkeit westlichen Denkens und der kraftvollen Lebenweise der nicht selten verzweifelt armen Kubaner. Damit hat der Roman einen Nerv getroffen, die Müdigkeit des ‚Weißen Mannes‘ ist (…) ein Thema unserer Wirklichkeit.“
(Lutz Hoyer, Dresdner Neueste Nachrichten/Beilage zur Buchmesse, 20/10/05)
„‚Herr der Hörner’ ist genau wie Goethes ‚Faust‘ eine Liebesgeschichte und eine Teufelsgeschichte – und deshalb (…) ein enorm deutsches Buch. Politycki ist ein enorm farbiger Roman gelungen über einen weißen Mann in einer schwarzen Kultur, den dünnen Firnis der Zivilisation – und darüber, daß wer mit dem Teufel Suppe essen will, einen sehr langen Löffel braucht.“
(Denis Scheck, Express Düsseldorf, 20/10/05)
„zunächst eine große Recherche-Herausforderung (…): Für einen Schriftsteller aus Europa ist es sensationell, das Vertrauen der Schamanen gewonnen zu haben. (…) Diese Nähe, das Authentische, spürt man als Leser dieses Romans auf jeder Seite. So packend hat dieses Kuba noch keiner beschrieben.“
(Gerald Giesecke, ZDF/Aspekte, 20/10/05)
„Fulminant erzählt, inklusive Hahnenkampf, Stampfen und Stinken, Duften und Singen und Tanzen. Und mitten in höchst drastischen Szenen breitet sich Ruhe aus, wunderbar.“
(Lutz Hoyer, Leipziger Volkszeitung/Beilage zur Buchmesse, 20/10/05)
„kraftvoll sinnlich (…), witzig (…), atmosphärisch mitreißend und spannend (…), berauschend schön. (…) Matthias Politycki schildert den kubanischen Alltag sehr genau. (…) Die faulige Üppigkeit mancher Ecken erinnert von ferne an Venedig. Ebenso wie die zunehmende Schlaffheit des Flaneurs an einen dortigen Spaziergänger denken läßt, den die Hitze ebenso erschöpft.“
(Sandra Kerschbaumer, Frankfurter Allgemeine Zeitung/Beilage zur Frankfurter Buchmesse, 19/10/05)
„eine künstlerische Antwort auf das hierzulande gassierende ‚Jammern auf hohem Niveau‘, ein leidenschaftlicher Appell zur Rückbesinnung auf die Werte der so genannten ‚zivilisierten westlichen Gesellschaft‘.“
(Peter Mohr, General-Anzeiger Bonn/Buchmessenbeilage, 19/10/05)
„Polityckis opulenter, funkelnder, sprachbesessener Roman (…) erzählt vom Absturz seines Helden – oder vielmehr von seiner Errettung, je nachdem, aus welcher Perspektive man seine Abenteuer betrachtet. In grandioser Genauigkeit schildert er die Alltagswelt in Santiago, den Staub, die gelben Hunde, die Katzenkadaver, die strengen Gerüche, den Tag-und-Nacht-Lärm, die vielfältig verschwitzten Hemden, die Bettler vor der Kathedrale, die Schlangen vor den Geschäften, die überlaufenden Wassertanks auf den Dächern, die Menschen der Nachbarschaft, die unentwegt ‚mentiras‘ austauschen (…). Langsam, fast unmerklich, kommt unter der geschäftigen Oberfläche des Lebens eine Tiefendimension aus religiösen Geheimnissen und Gerüchten zum Vorschein. (…) Dr. Broder Broschkus ist ein touristisch infizierter Dr. Faust der globalisierten Welt, der bereit ist, seine Seele zu verpfänden, um ‚etwas Stärkeres als Logik, Vernunft und Verstand‘ zu finden. (…) Broschkus‘ bedingungsloser Bereitschaft zur Selbstauslöschung steht allerdings das strenge Formbewußtsein des Erzählers entgegen. Es konterkariert den traurigen Helden durch einen leichten, tänzelnden Tonfall, der bei allem Glänzen- und Blendenwollen, bei aller strotzenden Sprachpotenz, unüberhörbar ironisch bleibt. Politycki hat schon im ‚Weiberroman‘ einen Manierismus der Sprache aus Wortschöpfungen und kunstvoll integrierter Umgangssprache entwickelt. Im ‚Herr der Hörner‘ bewährt sich der artifiziell saloppe Stil als Methode, sich in der Welt zu behaupten: (…) Politycki geht es um die Ästhetisierung auch des Archaischen. Aber wenn sein Roman schließlich in einem bizarren Menschenopfer gipfelt, behält die Ironie die Oberhand. So sehr es den armen Helden hinabzieht in den Orkus aus Blut und Magie, so unberührt heiter und formbewußt bleibt die Sprache des Romans. Die Stimme des ‚weißen Mannes‘ ist eben doch noch nicht verstummt.“
(Jörg Magenau, Süddeutsche Zeitung/Beilage zur Frankfurter Buchmesse, 18/10/05)
„ein Fest der Farben, Klänge und Gerüche, eine sprachgewaltige Suada auf die elementare Sinnlichkeit Kubas mit seinen lebensfrohen Bewohnern und kraftvollen Riten (…), ein mit Lust und Verve geschriebenes Buch, das trotz seines streckenweise ironischen Untertons nicht darüber hinwegzutäuschen vermag, daß unter der Oberfläche der gängigen Kuba-Klischees eine ebenso unheimliche wie faszinierende, von Blut, Gewalt und Okkultismus beherrschte Welt schlummert. (…) Tatsächlich wandelt Politycki auf den Pfaden Friedrich Nietzsches – wenn auch auf eine Weise, die dem Farbenreichtum und der Exotik seines rauschhaften Liebes- und Abenteuerromans durchaus zugute kommt. Denn was die wenigsten seiner Leser wissen: Politycki ist nicht nur ein guter Romanschriftsteller und Lyriker, sondern auch ein versierter Nietzsche-Forscher, der (…) zwei große wissenschaftliche Nietzsche-Bücher geschrieben hat.“
(Christoph Bartscherer, Landshuter Zeitung, 17/10/05)
„‚Herr der Hörner‘ wäre als Buch schon deshalb zu rühmen, weil es die gepflegte Nabelschau und den Deutschjammer der Mehrheit unserer Literaten meidet. Dieses Buch ist eine Riesenreportage über eine vitalistische Welt (…). Fast zwei Jahrzehnte nach dem Tod des Ethnopoeten Hubert Fichte nimmt Politycki dessen Spurensuche nach den afroamerikanischen Kulten wieder auf. Der Roman ist ein Riesenschmöker mit vielen komischen Partien, ein fesselnder Bilderbogen mit einem Gespinst aus Fantasy-Elementen und trotz aller schweren Rätsel ungemein leicht zu lesen.“
(Wilfried F. Schoeller, NDR kultur/Buch der Woche, 16/10/05; http://www.ndrkultur.de)
„Politycki zeigt am Beispiel von Broschkus den Untergang eines Menschen aus der modernen abendländischen Zivilisation in einer archaisch geprägten Welt, die nach ganz anderen Regeln und Normen funktioniert. (…) Hunde- und Hahnenkämpfe, Exhumierungen, Hausschlachtungen und Katzenopfer im Grasland oberhalb der Stadt gehören zu den Proben, denen sich auch der Leser aussetzen muß und wo auch die Sprache aus der Reserve kommt.“
(Dietholt Zerweck, Eßlinger Zeitung, 16/9/05)
„Mit Thomas Mann kann Matthias Politycki jetzt sagen: Dieses habe ich groß gewollt, denn groß ist seine Parabel auf die Erlösungssehnsucht des weißen Mannes wahrlich geworden. Das alte deutsche Motiv vom Wanderer, der in fremden Landen wiedergeboren wird, hat er neu gefaßt. Und die schillernden kubanischen Farben stehen dieser Fassung sehr gut.“
(Tilman Krause, Die Welt/Favoriten, 15/10/05)
„strotzt nur so vor Leben“
(Anne Diekhoff, Neue Osnabrücker Zeitung, 15/10/05)
„Irgendwie scheint es nicht mehr gefragt zu sein, daß sich die Dichter und Denker dieses Landes zum politischen Geschehen äußern und sich ungefragt einmischen. (…) Eine Ausnahme sei an dieser Stelle gepriesen: Matthias Politycki. Immer mal wieder setzt er unorthodoxe und tabubrechende Gedanken in die Welt. Sie sind es auch, die sein neues Buch ‚Herr der Hörner‘ so bemerkenswert machen. Politycki hat einige Zeit auf Kuba gelebt (…). Aus dem erlittenen Kulturschock und der drastischen Verschiebung von Prioritäten hat Politycki etwas Großartiges gemacht: ein spannendes, tiefgründiges und heiteres Buch, dem viele Leser zu wünschen sind. (…) Skurrile Geschichten, unvergeßliche Charaktere, ein spannender Plot – dieses Buch hat von allem wirklich reichlich. (…) Der Leser kann sich der Faszination der Geschichte nicht entziehen. (…) Politycki liebt Kuba und seine Menschen, das erzählt dieser manchmal so verstörende Roman in einer schönen, bildhaften Sprache auch und nicht nur am Rande.“
(Bettina Schmidt, Sächsische Zeitung, 15/10/05)
„Matthias Politycki (…), seit ‚Weiberroman‘ als feuriger Erzähler geschätzt, schickt einen Hamburger Banker namens Broder Broschkus auf Kuba-Urlaub. (…) Die so lustvoll erhoffte Unternehmung (wird) bald zu einer Reise ins finstere Herz kubanischer Volksreligionen.“
(Peter Zemla, Buchjournal Nr.3, 14/10/05)
„Polityckis Text rockt, er pulsiert, sein Rhythmus reißt (…) mit.“
(Annette Scheepers, Rheinische Post, 14/10/05)
„Anstatt auf die Spur seines Mädchens gerät er (Broder Broschkus) auf allerlei geheimnisvolle Um- und Abwege. So verwandelt sich seine Personenfahndung in eine Suche, die auf Bedeutenderes zielt. Und damit rückt Broder Broschkus auf in die erste Liga der Suchenden, jener legendären Sucher nach dem Heil, dem Gral, dem Kraftquell oder dem Weltgeheimnis. Obwohl nur ein sehr ferner Nachfahre des Parzival, geht es auch bei ihm um (…) einen magischen Kessel. (…) Mit federnder narrativer Rhetorik führt der Erzähler seinen Helden durch den kubanischen Alltag. Die szenischen Schilderungen der kleineren und größeren Abenteuer sind höchst lebendig, der Mikrokosmos der Straßen und Winkel Santiagos entfaltet sich mit einem erstaunlichen Wahrnehmungsreichtung der Farben, Geräusche, Gerüche, Texturen, Atmosphären. Dieser Gestus der überschwenglichen (…) Erzähllaune hält sich bis zum Ende, ohne an Spannkraft zu verlieren. Das ist eine Leistung, und es ist auch glanzvoll.“
(Eberhard Falcke, DIE ZEIT/Beilage zur Buchmesse, 13/10/05)
„Ein echter Wälzer zum Eintauchen. (…) Politycki in Höchstform“
(Claudia Hötzendorfer, Neue Ruhr Zeitung, 11/10/05)
„Man kann es sehen, hören, riechen und fühlen in diesem Roman: Santiago de Cuba. Die feuchte Hitze, die das Hemd binnen kurzem am Körper kleben läßt, den Schweiß, den allgegenwärtigen Uringeruch, den Rum und das Meer. Das Blut der frisch geschlachteten Schweine (…) die trostlose Armut, die Korruption und das pralle, gewalttätige, gierige Leben.“
(Ruth Fühner, Hessischer Rundfunk/Mikado, 10/10/05)
„Matthias Politycki zelebriert ein Festival der Sinne; Atmosphäre und Ambiente, Geräusche, Gerüche (…) werden wunderbar eingefangen – Spannung herrscht vom ersten Augenblick an. (…) Mit anheimelndem Sarkasmus wird das gesamte mitteleuropäische Existieren abgefertigt. Mit Liebe zum ruinösen Detail widmet sich der gut sortierte Autor dem allgemeinen Verfall in Santiago (…). Wer die Schuhe putzen will, benutzt einen Kater dazu. Fahrräder werden nicht gewaschen, sondern durch Handauflegen gereinigt. Aus alldem konstituiert sich eine Komik, die auch über große Strecken hin nicht ihren Reiz verliert.“
(Udo Dickenberger, Stuttgarter Nachrichten/Buch der Woche, 6/10/05)
„Teufel auch! Dieses Buch geht unter die Haut. (…) Mit seinen kraftvollen Schilderungen vermag der Roman seine Leser zu bannen, zugleich wird durch stilistische Finessen, Witz und Ironie stets Distanz gewahrt. (…) Matthias Politycki berührt mit seinem Roman einen Nerv, der auch nach 735 gelesenen Seiten nicht aufhört zu rumoren.“
(Christina Rademacher, Salzburger Nachrichten, 1/10/05)
„Ein Roman voller Sehnsucht, wortgewaltig wie Poesie.“
(Petra, Oktober 2005)
„ein Wahnsinns-Werk (…). Sprachgewaltig beschwört Politycki Bilder, die an Psycho-Trips wie ‚Angel Heart‘ erinnern. Ein Leseerlebnis, das beweist, daß dieser auch Autor auch mit 50 alles andere als in der Krise ist.“
(Angela Wittmann, Brigitte Nr. 21, 28/9/05)
„Siebenhundertsechsunddreißig Seiten. Neunhundertfünfzig Gramm Papier. Wer einen derart langen, derart gewichtigen Roman schreibt, der braucht dafür einen guten Grund. Um es voreweg zu nehmen: Matthias Politycki (…) hat sogar einen sehr guten. Denn ‚Herr der Hörner‘ ist die Geschichte einer Obsession, eines Absturzes ins Herz der Finsternis, einer Verwandlung. Einer Verwandlung, die so tiefgreifend und so düster ist, daß man sie in einer knapperen Form kaum glaubhaft schildern könnte.“
(Verena Carl, Spiegel-Online, 9/05; http://www.verenacarl.de)
„Das beste Buch des Jahres: Matthias Politycki ist der Herr der Sprache.“
(Elke Serwe, Für Sie 20/2005, 20/9/05)
„Das ist grandios erzählt. Es stampft und stinkt und duftet und singt. Und neben drastischen Szenen mit Hahnenkampf, Hausschlachtung oder Blutritual gibt es wunderbare Momente der Ruhe, in denen die ganze Schönheit des ’schwarzen Südens‘ von Kuba aufscheint. (…) ‚Herr der Hörner‘ gehört – so farbig und schräg er geschrieben ist – ins Genre des klassischen Entwicklungsromans (…). Auch im Roman verschafft sich die kritische Vernunft immer wieder Gehör. Bei aller Intensität der Beschreibung ist der Text mit Witz und Ironie angereichert.“
(Stefanie Schütte, dpa, 19/9/05)
„Der Autor besticht durch präzise Beobachtungen, erweist sich als Insider, wenn er die Atmosphäre um den Parque Céspedes und auf anderen Verkehrsadern Santiagos präzise und mit wunderbarer Ironie beschreibt. Oder die Mißgunst unter den Nachbarn, deren Mißtrauen und üble Nachrede (…) Politycki gibt einen genauen, großenteils authentischen und noch dazu faszinierend zu lesenden Einblick in die beiden Hauptstränge kubanischer Mischreligionen: die aus Westafrika überlieferte Santería sowie den animistischen, aus dem Kongo-Becken stammenden Palo-Monte-Kult. Damit erschließt sich dem Leser ein Stück spannender Kulturgeschichte (…). Das ist, mit all seinen arachaisch-blutigen Opferzeremonien sowie etlichen Schutz- und Schadenzaubereien, spektakulär inszeniert.“
(Roman Rhode, Der Tagesspiegel, 18/9/05)
„nicht nur der Roman einer Midlife-Crisis, sondern der Roman einer politischen Krise, ja mehr noch, einer Zivilisationskrise (…): eine Generalabrechnung mit Deutschland (…), eine tolle Geschichte“
(Denis Scheck, Deutschlandfunk/Büchermarkt, 16/9/05)
„ein insgesamt sehr bunter und farbiger Roman (…), von den atmosphärischen Beschreibungen her ein sehr dichtes und gelungenes Buch“
(Julia Schröder, Deutschlandfunk/Büchermarkt, 16/9/05)
„ein großer Wurf (…), riskiert viel, viel mehr als die meisten anderen deutschen Romane“
(Rainer Moritz, Deutschlandfunk/Büchermarkt, 16/9/05)
„eines der ungewöhnlichsten deutschen Büchern der letzten Jahre“
(Volker Isfort, Abendzeitung Nürnberg, 13/9/05)
„räumt mit den gängigen Kuba-Klischees auf“
(Martina Scherf, Süddeutsche Zeitung/Münchner Kultur, 13/9/05)
„Der Roman ist bei allem Furor auch urkomisch. Die Übergänge zwischen phantastischem Realismus, Abenteuerroman, Geisterstunde, Rausch und Trash sind fließend. (…) So leidenschaftlich, hitzig, wuchtig, maßlos, farbig, schrill und authentisch hat noch kein deutscher Schriftsteller von Kuba erzählt. Der Roman ist dokumantarisch exakt bis hinein in die verwinkelten Gassen, in die Gebräuche, Riten und Rituale. Er ist, inklusive aller stilistischen Eigenheiten, famos geschrieben. (…) Der turbulente und mit einem irren apokalyptischen Finale endende Roman besteht den kühnen Balanceakt zwischen Irrationalismus und Aufklärung, Exotismus und Zivilisationskritik bravourös. (…) Überbordende Fabulierlust und anthrophologische Forschung stehen sich nicht im Weg. Die Unbedingtheit, mit der der Autor sich – und uns Lesern – Erleuchtungen gönnt und uns am Ende doch ins Verderben schickt, wühlt auf.“
(Hajo Steinert, Focus 37/2005, 12/9/05)
„(kommt) als düster-farbiger Karibik-Thriller daher und zugleich als Satire auf europäische Distinguiertheit. (…) Daß Politycki weiß, wovon er spricht, merkt man diesem lebendigen, aufschlußreichen Roman auf jeder Seite an. (…) ein großes Lesevergnügen ist dieser spannende und amüsante Roman auf jeden Fall.“
(Alexander Altmann, TZ München, 12/9/05)
„In rauschhafter Sprache mit Witz und Ernst, Ekel und Ehrfurcht und großer Akribie beschreibt der Autor die Traurigkeit der Tropen und liefert ein Kubabild jenseits bekannter Klischees. Anders gesagt: Den Wenders verspeist Politycki zum Frühstück.“
(Volker Isfort, Abendzeitung München, 12/9/05)
„der Roman einer Grenzüberschreitung“
(Julia Encke, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 11/9/05)
„ein Blick ins Herz der Finsternis“
(Denis Scheck: Sichere Bestseller für den Herbst, WELT AM SONNTAG, 11/9/05)
„wuchtig grimmig (…), bravourös joungliert“
(Frank Keil, DIE WELT/Hamburg, 10/9/05)
„‚Herr der Hörner‘ (…) ist nichts weniger als die Apotheose der von Nietzsche empfohlenen ‚dionysischen Weltanschauung‘.“
(Gunther Nickel, DIE WELT, 10/9/05)
„Matthias Politycki beschreibt die Stadt (Santiago de Cuba) und das Leben der Menschen so suggestiv und so genau, daß es kein Entrinnen gibt. Es zieht einen förmlich in dieses Buch hinein, einmal angefangen, macht es süchtig nach mehr. (…) Ein teuflischer Roman also: verwirrend, packend und provozierend.“
(Heide Soltau, NDR Info, 9/9/05)
„ein Roman, der in der Tat viel wagt und in seinen dichtesten Passagen Bilder von Kuba malt, die sich mit großen Vorbildern messen können“
(Julia Schröder, Stuttgarter Zeitung, 9/9/05)
„Nicht einfach aufgeschrieben ist das, sondern erlebt.“
(Jens Büchsenmann, NDR 90,3, 8/9/05)
„ein hoch poetischer, großartiger Gegenwartsroman, in dem die Regeln und Gewißheiten der vermeintlich aufgeklärten Welt unversehens von der geheimnisvollen Mechanik des Bösen eingeholt werden“
(Jürgen Abel, Literatur in Hamburg, September 2005)
„ein großer Wurf, der sich nicht scheut, die Literatur wieder auf ‚große‘ metaphysische Fragen zu beziehen (…), einer der großen Romane dieses Herbstes (…) – ein Text, dessen Sprache dem Rhythmus seiner Figuren geschmeidig und wandlungsreich folgt und der eindrücklich belegt, daß sich das Gewicht von Romanen nicht zuletzt an der Sprachmächtigkeit ihrer Autoren mißt“
(Rainer Moritz, Literaturhaus Hamburg, September 2005)
„Mit brillantem Sprachwitz läßt Politycki einen Zivilisationskranken poco a poco – Schritt für Schritt – sein altes Ich abstreifen und präsentiert dabei subtil ein eindrucksvolles Kuba-Portrait.“
(Jennifer Ots, Flensburger Tageblatt, 30/8/05)
„harte kubanische Realität fernab aller Buena-Vista-Social-Club-Romantik (…), kunstvoll miteinander verwobene Figuren“
(Jennifer Ots, Husumer Nachrichten, 30/8/05)
„hemmungslos saftig-sinnlich“
(Richard Kämmerlings, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15/8/05)
Bilder, wie sie nicht im Buche stehen
Photos und Skizzen zeigen relevante Personen, Orte, „Unterschriften“ und Darstellungen von Heiligen bzw. Göttern der afrokubanischen Religionen. Jede Woche wird hier ein anderes Bild zum „Herrn der Hörner“ angezeigt.
Personen
Heilige und Götter
Orte
Landkarte, Stadtplan, Handlungsorte
Der Roman spielt im Südosten Kubas, zu großen Teilen in der Küstenstadt Santiago de Cuba.
Hörproben
Herr der Hörner
Sound der Stadt – Webradio
Videos
Beitrag bei Aspekte/ZDF am 20.10.2005
Mit freundlicher Genehmigung © Gerald Giesecke/ZDF Aspekte, 2005.

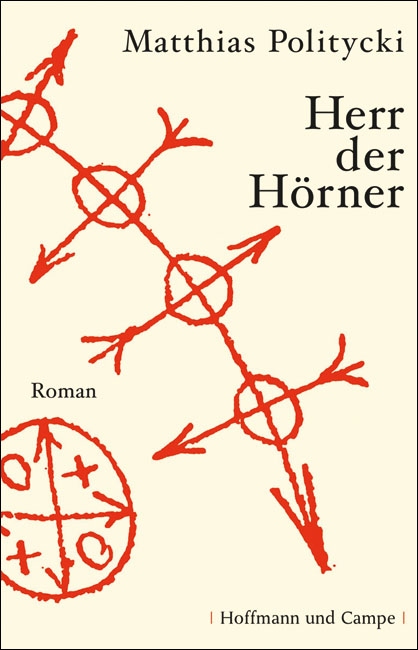
 (dänisch/dansk)
(dänisch/dansk) (spanisch/español)
(spanisch/español) (englisch/english)
(englisch/english)










































